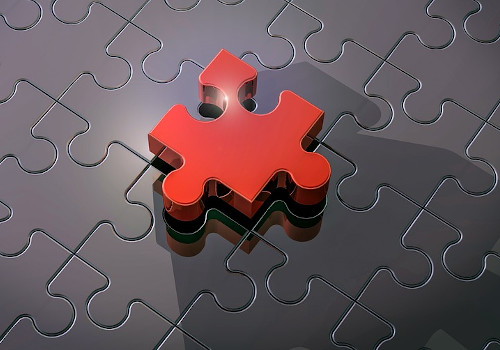obschon
Stil
regional
schriftsprachlich
Syntaktische Klasse
Subjunktor
Ivy hatte drei Stunden lang, während wir auf die verspätete Maschine warteten, auf
mich eingeschwatzt, obschon sie wußte, daß ich grundsätzlich nicht heirate. (Frisch, Max: Homo faber [Roman] (Erstv. 1957). Frankfurt a.M.: 1966, S. 7)
Zweifel am Sion-Sieg scheint niemand zu haben, obschon die Matchuhr bereits die
letzten fünf Minuten anzeigt. (St. Galler Tagblatt, 9.7.1997, o. S.)
Baptist und Sabeth reden weiterhin über van Gogh, Lewin und ich reden über
Dieselmotoren, wobei ich, obschon in Dieselmotoren interessiert, das Mädchen nicht aus den Augen lasse. (Frisch, Max: Homo faber [Roman] (Erstv. 1957). Frankfurt a.M.: 1966, S. 94)
Stellung
vor internem Konnekt
Reihenfolge der Konnekte
anteponiert
Obschon er leidend ist, übt er noch viele Funktionen aus.
Ruhpolding liegt hier; über Ruhpolding aber der „Berghof“, ein ganz neues kleines Alpenkurhaus. Obschon es neu ist, hat es keine düster tuende Bauernstube, sondern Räume, die das Licht in vollen Zügen hereintrinken und mit kostbaren alten und köstlich neuen Möbeln und Kunstwerken versehen sind. (Die Zeit, 26.3.1953, S. 15)
postponiert
Er übt noch viele Funktionen aus, obschon er leidend ist.
Dies war für Tuchel ein Argument, ihn gegen Bürki zu tauschen, obschon auch der im Passspiel durchaus noch Luft nach oben hat. (Neue Zürcher Zeitung, 29.11.2016, S. 43)
eingeschoben
Er übt, obschon er leidend ist, noch viele Funktionen aus.
Hier zeigt sich, obschon diffamierende Adjektive vermieden werden, eine seltsame Verstocktheit an, die eines Papstes deutscher Herkunft nicht gut zu Gesicht steht. (Die Zeit (Online-Ausgabe), 28.5.2009, o.S.)
Damit leistet er, obschon dies kaum in seinem Blickfeld ist, jenen "Arena"-Tauglichen Schützenhilfe, für die es stets nur Schwarz oder Weiss gibt. (Die Südostschweiz, 16.11.2009, o.S.)
Besonderes Format der Konnekte
internes Konnekt Verbletztsatz
internes Konnekt Nichtsatz:
a) Weglassung von Subjekt und Kopula:
Sie wirkt, obschon ständig im Stress, völlig ruhig.
Ich erlebte es einige Jahre später, als ich, obschon für solcherlei Handfertigkeiten ausserordentlich unbegabt, für meine Mutter eine Tischdecke stickte. (Neue Zürcher Zeitung, 24.12.2016, S. 44 - 45)
b) Reduzierung auf minimalen Fokusausdruck:
Sie hat, obschon mit Zähneknirschen, eingewilligt.
Sein feines Gespür für Schnee und Schliff lassen sich erahnen, wenn er davon erzählt, dass nicht jede Schleifrolle, obschon von der exakt gleichen Serie, das gleiche Ergebnis liefere. Und dass nicht jeder Ski, obschon vom gleichen Typ, mit derselben Behandlung gleich schnell werde. (St. Galler Tagblatt, 23.12.2016, o.S.)
Seine Bilder, obschon unbewegt, scheinen wie alte Fernsehbildschirme oder schlechte Computermonitore zu flirren und zu grieseln. (Die Rheinpfalz, 1.12.2016, o.S.)
Korrelatkonstruktion mit
so (...
doch) bei Linksversetzung der Subjunktorphrase:
Obschon es ihm keinen Spaß macht, so wehrt er sich doch nicht
dagegen.
Obschon sie in Ungarn 30 Prozent der ausländischen Partner in Gemeinschaftsunternehmen stellen, so bleiben sie doch im Bezug auf das Investitionskapital weit hinter den USA zurück. (Süddeutsche Zeitung, 13.3.1992, S. 0)
Obschon seine Worte spöttisch gemeint waren, so schwang in ihnen doch Respekt und ein klein wenig Furcht mit. (profil, 1.10.2007, S. 108)
Semantische Klasse
konzessiv (
HDK Abschnitt C4.3)
Obschon er leidend ist, übt er noch viele Funktionen aus.
Obschon in fast jedem Haushalt die üblichen Weihnachtsrituale wiederzufinden sind, feiern alle ein wenig anders. (St. Galler Tagblatt, 24.12.2016, o.S.)
Bedeutung
Der im externen Konnekt bezeichnete Sachverhalt steht im Widerspruch zu einem
normalerweise aus dem internen Konnekt ableitbaren Sachverhalt.
Also hat man mich nicht einsparungshalber hinausgeworfen. Sondern als Juden. Obschon ich im Felde war usw. usw. (Victor Klemperer: [Tagebücher 1935], in: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, Bd. 1. Berlin: 1995, S. 198)
An diesem Tag unterschrieben Englands Außenminister Samuel Hoare und Hitlers Außenberater Joachim von Ribbentrop das deutsch-britische Flottenabkommen, das die Stärke der deutschen Kriegsmarine für alle Zeiten auf 35 Prozent der Briten-Flotte begrenzen sollte.
Obschon der zur Aufrüstung entschlossene Hitler damit eine doppelte Überlegenheit Englands auf dem Wasser anerkannte, eröffnete dieser Verzicht dem Dritten Reich ungeahnte Möglichkeiten: [...] (Der Spiegel, 5.9.1962, S. 33)