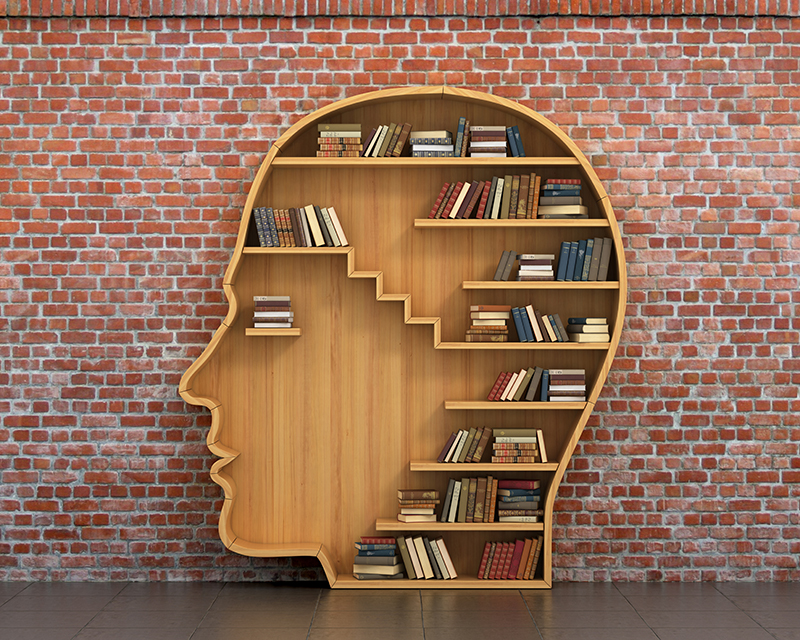Grammatik in Fragen und Antworten

Im Schwarzwälder Bote oder im Schwarzwälder Boten? — Flexion komplexer Eigennamen nach Präpositionen
Selten scheint die Antwort auf eine Frage zu einem grammatischen Zweifelsfall so leicht wie in diesem Fall, denn mit der Wahl von im ist im Grunde bereits entschieden, dass die gesamte Sequenz als normale Präpositionalphrase zu betrachten ist. Auf die Präposition im folgt üblicherweise eine Phrase im Dativ (wem-Fall) oder Akkusativ (wen-Fall) – jedenfalls bei Sprechern und Schreibern, die sich am Standard orientieren – und Dativ bzw. Akkusativ von Bote lauten nun einmal Boten.
Soweit die grammatische Theorie. Sucht man, deren Geltung durch Recherchen in großen Textkorpora zu bestätigen, dann stellen sich doch unerwartete Beobachtungen ein, die nachvollziehen lassen, wie es hier überhaupt zu Zweifeln kommen konnte. Hier einige Beispiele:
Im gesamten Referenzkorpus DeReKo lassen sich im März 2024 neben 702 Belegen für Präpositionalphrasen vom Typ im *** Boten immerhin 109 Belege vom Typ im *** Bote nachweisen. Neben dem "Schwarzwälder" finden sich darunter u.a. der "Bargfelder", "Kronberger", "Märkische" oder "Osttiroler" Bote. Auf die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wurde 7.749 Mal mit der flektierten (gebeugten) Form Frankfurter Allgemeinen Zeitung Bezug genommen, doch auch 311 Mal mit der unflektierten Form Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo der Theorie nach eine flektierte Form zu erwarten gewesen wäre. Ähnlich zeigen sich die Verhältnisse bei Referenzen auf den "Trierischen Volksfreund". In allen drei Fällen treten die unflektierten Formen häufig in Verbindung mit Anführungszeichen auf («Frankfurter Allgemeine Zeitung», "Schwarzwälder Bote"). Die Schreiber gingen offenbar davon aus, dass mit der Setzung der Anführungszeichen die Namen der Zeitungen den Charakter wörtlicher Zitate erhalten, die unverändert zu bleiben haben.
| im [] Bote | 109 Belege |
| im [] Boten | 702 Belege |
| in der Frankfurter Allgemeine Zeitung | 311 Belege |
| in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung | 7.749 Belege |
| im Trierischer Volksfreund | 8 Belege |
| im Trierischen Volksfreund | 202 Belege |
Erweiterte Fragestellung
Aber vielleicht zielt die Titelfrage auch auf ein ähnlich gelagertes Problem, das zwar beim Schwarzwälder Boten gar nicht auftreten kann, denn der heißt tatsächlich einfach "Schwarzwälder Bote", jedoch durchaus bei anderen Zeitungen, bei denen zum Namen bereits der definite (bestimmte) Artikel gehört:
- Das Neue Blatt
- Die Glocke
- Die Harke
- Der neue Tag
- Der Patriot
- Die Rheinpfalz
- Der Spiegel
- Der Tagesspiegel
- die tageszeitung
- Die Welt
- Die Woche
- Die Zeit
Hier bestünde grundsätzlich die Option, die gesamte Bezeichnung unflektiert zu lassen, ganz so, wie dies etwa bei Titeln von Filmen und zum Teil auch von Büchern üblich ist:
Stattdessen zu sagen: "vom Mann ohne Eigenschaften" oder "im mit dem Wolf tanzt" dürfte eher irritierend wirken. Bei Namen von Zeitungen ist es allerdings durchaus üblich, den definiten Artikel, der an sich Bestandteil des Namens ist, zu flektieren:
Nur selten finden sich auch Belege, in denen die Bezeichnung nicht flektiert wird, wie etwa hier:
Man kann wohl davon ausgehen, dass bei dieser Form, Quellen anzugeben, schriftlich weitgehend durch die Verwendung von Anführungszeichen und/oder Groß- bzw. Kleinbuchstaben (etwa DIE WELT, die tageszeitung) klargestellt wird, dass hier ein Namenszitat vorliegt. Die Ausnahme bestätigt hier vermutlich die Regel:
Doch mit der Feststellung, dass es üblich ist, Bezeichnungen von Zeitungen zu flektieren, ist noch nicht erklärt, wieso sich diese so anders verhalten als Buch- und Filmtitel. Klare Regeln oder allgemein gültige Konventionen gibt es hierfür wohl nicht, nur eine Vermutung: Flektiert werden die bestimmten Artikel dann, wenn von den entsprechenden Zeitungen im Alltag des Landes oder der jeweiligen Region häufig die Rede ist. Eine Irritation, wie sie bei weit seltener genannten Buch- und Filmtiteln eintreten könnte, bleibt aus, weil diese Zeitungen derart bekannt sind, dass jedermann sofort versteht, was mit entsprechenden Phrasen gemeint ist. Zugleich würde ein ständig wiederkehrender Bruch im syntaktischen Aufbau von Phrasen wie "in der Spiegel" wohl als störend empfunden. Aber das ist, wie gesagt, nicht mehr als eine Vermutung.
Fazit
Wer dies unbefriedigend findet, mag sich an das halten, was sich bei Recherchen in riesigen Textkorpora — siehe oben — als präferiert erweist, und das ist eindeutig die flektierte Form, in normaler Schreibung oder auch in Verbindung mit Anführungszeichen oder Großbuchstaben, also etwa aus dem "Spiegel", in der "WOCHE".
Zum Text
- Schlagwörter
- Autor(en)
- Bruno Strecker
- Bearbeiter
- Roman Schneider
- Letzte Änderung
- Aktionen
-
Seite merken
Seite als PDF
Seite drucken
Seite zitieren
- Seite teilen