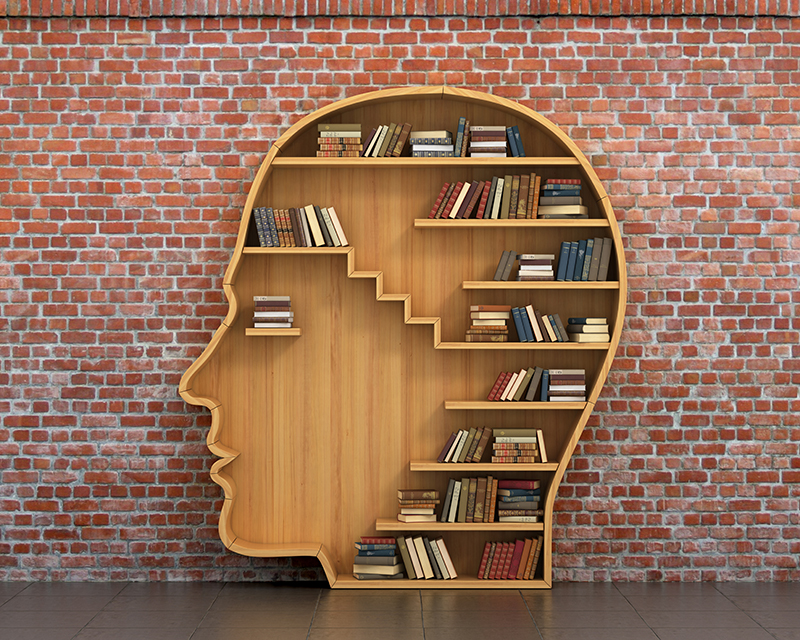Grammatik in Fragen und Antworten

Behelfe ich mir oder mich? — Kasus des Reflexivums bei behelfen
Mit Dank und freundlichen Grüßen aus B.
U.K.
Als uns diese Frage erreichte, schien die Antwort den meisten Kollegen sofort klar. Dumm nur, dass sie nicht bei allen gleich ausfiel: "Natürlich nur ich behelfe mir!" – "Unsinn, korrekt ist: ich behelfe mich. Schließlich sagst du doch auch nicht ich bedanke mir oder ich begnüge mir". Bemerkenswert war dabei vor allem die Sicherheit, mit der die jeweilige Position vertreten wurde, was zeigt, wie recht die Fragestellerin mit ihrem Hinweis auf große Uneinigkeit hatte.
Untersuchung des Sprachgebrauchs
Grund genug, den allgemeinen Sprachgebrauch genauer zu untersuchen. Doch die Hoffnung, über Recherchen in großen Textkorpora zu einer Entscheidung zu kommen, wird dadurch gedämpft, dass behelfen nicht gerade zu den Rennern unter den deutschen Verben zählt: Das Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch (OWID) ordnet behelfen in Frequenzschicht VII ein und im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache lassen sich (im Februar 2024) unter vielen Milliarden Wortformen gerade mal 26.865 Belege für die verschiedenen Formen von behelfen nachweisen. Zum Vergleich: Für helfen finden sich 4.859.065 Belege, für gehen gar 34.223.498 Belege.
Weitaus die meisten der an sich schon recht seltenen Korpusnachweise für behelfen sind Formen der 3. Person (sie behalf sich, er hat sich beholfen) oder Plural-Formen (wir behelfen uns, sie behalfen sich), mithin Vorkommen, bei denen auf der Wortoberfläche kein Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ zu erkennen ist. Wir konzentrieren uns im Folgenden deshalb auf Formen der ersten und zweiten Person im Singular.
Tatsächlich wäre die Antwort auf die Titelfrage noch vor wenigen Jahrzehnten ganz eindeutig ausgefallen, nämlich mit einer Entscheidung für Ich behelfe mich, du behalfst dich. Eine Suche in Texten der Digitalen Bibliothek (Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky) fördert unter insgesamt 468 Belegen für Formen von behelfen 73 Belege für behelfen mit eindeutig erkennbarem Akkusativ (mich/dich) und lediglich einen Beleg mit Dativ (mir) bei Gottfried Keller hervor.
Aus Texten der Digitalen Bibliothek:
[Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621–1676): Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. DLT, S. 206752]
[Johann Gottfried Schnabel (1692-1751/58) : Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier. DLT, S. 485046]
[Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781): Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglück. DLT, S. 344963]
[Johann Wolfgang v. Goethe (1749-1832): Italienische Reise. DLT, S. 177199]
[Jacob und Wilhelm Grimm (1785-1863): Deutsche Sagen. DLT, S. 205948]
[Theodor Fontane (1819-1898): Graf Petöfy. DLT, S. 124589 ]
[Heinrich Heine (1797-1856): Reisebilder. Dritter Teil. Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, S. 244493]
[Karl May (1842-1912): Und Friede auf Erden! DLT, S. 383791]
[Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898): Angela Borgia. DLT, S. 390353]
[Richard Wagner (1813-1883): Mein Leben.DLT, S. 557668 ]
Ein Blick in die aktuellen DeReKo-Sprachdaten zeigt ein Bild, das vor allem konservativere Sprachteilhaber vor diesem sprachgeschichtlichen Hintergrund einigermaßen überraschen dürfte:
| mir (Dativ) | mich (Akkusativ) | |
| habe ich ... beholfen | 28 | 25 |
| ich habe ... beholfen | 4 | 2 |
| behalf ich | 13 | 6 |
| ich behalf | 0 | 1 |
| ich behelfe | 7 | 4 |
| ich ... behelfen | 37 | 28 |
| du behilfst | 0 | 0 |
| du ... behelfen | 5 | 0 |
| behilfst du | 0 | 0 |
| insgesamt | 94 | 66 |
Die DeReKo-Recherche erfolgte über KorAP. Als Abfragesprache kam Poliqarp zum Einsatz, um Grundformen einzubinden, Wortabstände festzulegen und die Belegstellen innerhalb eines Satzes zu verorten. Belege zu habe ich mich beholfen (mit beliebigen optionalen Wörtern zwischen mich und beholfen) wurden beispielsweise vermittels der Suchabfrage "[base='haben'] ich mich []* beholfen within s" recherchiert: Eine Wortform mit Lemma haben vor der Wortfolge ich mich, mit beliebigem Wortabstand gefolgt von beholfen innerhalb des selben Satzes.
Hier zeigt sich, insgesamt betrachtet, ein deutliches Übergewicht der Dativ-Formen. Da aber die Ausbeute dann doch recht spärlich ausfällt und speziell Belege zur zweiten Person Mangelware sind, schauen wir flankierend mit Hilfe von Google im Internet nach. Dabei müssen wir allerdings auf komplexere diskontinuierliche Suchmuster verzichten (zur Nutzung von Internet-Suchmaschinen für linguistisch motivierte Datenerhebungen vgl. Wie kommt man zu empirischen Aussagen?):
| mir (Dativ) | mich (Akkusativ) | |
| behalf ich | 1.770 | 2.260 |
| ich behalf | 1.290 | 937 |
| ich behelfe | 11.900 | 3.590 |
| du behilfst | 210 | 95 |
| behilfst du | 328 | 366 |
Interpretation der Datenlage
Bemerkenswert ist in Anbetracht einer solchen Datenlage, wie überzeugt die meisten von uns Befragten davon waren, dass ihre Einschätzung die richtige sei. Etwas mehr Selbstzweifel hätte man erwarten können. Die Erklärung dafür kann nur tentativ sein: Wie immer und überall stützen Sprachteilhaber sich in ihrem Sprachgebrauch auf Analogien und Regularitäten, die sie zu erkennen glauben. Bei hochfrequenten Erscheinungen kommen sie dabei sehr bald zu Einschätzungen, die hinreichend ähnlich sind, um keine Uneinigkeit aufkommen zu lassen. Bei eher selten gebrauchten Ausdrücken und Ausdruckssequenzen können sich alternative Einschätzungen jedoch nachhaltig nebeneinander etablieren. Im Fall von behelfen mit Dativ bzw. Akkusativ dürften diese in der Sache inkommensurablen Überlegungen oder auch intuitiven Einschätzungen ausschlaggebend gewesen sein:
- Ein eher formaler, grammatischer Gesichtspunkt: behelfen wird in einer Reihe gesehen mit reflexiven be-Verben wie besinnen,bedanken,betrinken,beschweren,beklagen,begnügen,bequemen,bescheiden mit akkusativischem Reflexivum. Hinzu kommt noch eine gewisse sachliche Nähe zu dem, was mit manchen dieser Verben zum Ausdruck gebracht werden kann: Wenn ich mich mit etwas behelfen muss, heißt das oft auch, dass ich mich damit begnügen oder bescheiden muss.
- Ein mehr sachlicher Gesichtspunkt: Wer sich mit etwas behilft, hilft damit auch jemandem (Dativ!), nämlich sich selbst in einer Angelegenheit, in der eine andere, an sich bessere Lösung nicht verfügbar ist. Die inhaltliche Nähe von helfen zu sich behelfen konnte offenbar für viele Sprachteilhaber den traditionell eindeutig gegebenen Bedeutungsunterschied so stark überlagern, dass sie den reflexiven Charakter des mich nicht mehr sahen und stattdessen mit mir einen Bezug zum Nutznießer des Helfens herstellten.
Fazit
Die Antwort auf die Frage, was denn nun korrekt sei, steht damit immer noch aus, und, so viel sollte klar geworden sein, das wird sich auch kaum ändern, solang die Frage rein sachlich zu entscheiden ist. Ängstlichen Sprachteilhabern, die sehr auf korrekte Ausdrucksweise bedacht sind, wird dies nicht gefallen, aber ihnen bleibt als Trost, dass niemand in der Lage sein wird, ihnen in dieser Sache ernstlich einen Fehler nachzuweisen.
Zum Text
- Schlagwörter
- Autor(en)
- Bruno Strecker
- Bearbeiter
- Roman Schneider
- Letzte Änderung
- Aktionen
-
Seite merken
Seite als PDF
Seite drucken
Seite zitieren
- Seite teilen