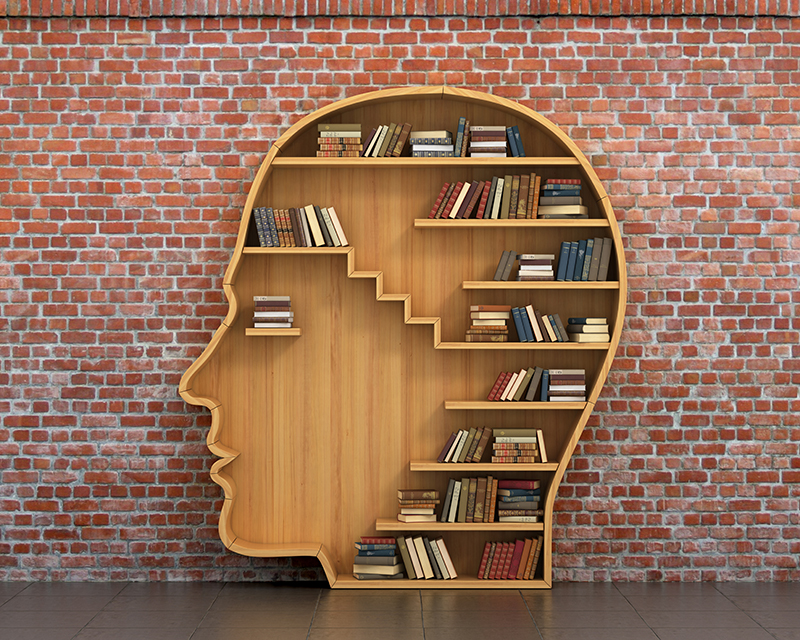Grammatik in Fragen und Antworten

Wohin man sich begeben kann: In die Stadt, aufs Land, zur Großmutter, unter die Leute, zum Bahnhof, in den Bahnhof, nach Aldi, nach Frankreich, in die Schweiz — Wahl der Präposition
Aufmerksamen Hörerlesern fällt immer wieder auf, dass Präpositionen in gleichen Kontexten variieren. So heißt es zum Beispiel schon innerhalb der Wochenzeitung Die Zeit:
[Die Zeit, 24.11.2005, o.S.]
Marschiert hier tatsächlich eine Kolonne finsterer Klassenkämpfer und DDR-Nostalgiker aufs Rathaus? Oder ist die PDS, vom Strahlemann Gysi domestiziert, mittlerweile eine Partei, vor der niemand Angst haben muss?
[Die Zeit 20.6.2001, S. 11]
»Beim kleinsten Problem kamen die Leute lieber zu ihr als ins Rathaus«, erinnert sich Ortsbürgermeister Jean Bellot. »Ich musste ihr oft sagen: Ein Abgeordneter ist ein Gesetzgeber, kein Sozialarbeiter.«
[Die Zeit 16.3.2006, o.S.]
Ist denn alles richtig? Ist alles geeignet, das auszudrücken, was wir ausdrücken wollen?
Ein zentraler Verwendungskontext für Präpositionen ist das Wohin, diese Präpositionen werden auch direktionale Präpositionen genannt. Wir stellen sie meist in Kontexte mit Verben oder Verbgefügen der Bewegung wie gehen, laufen, eilen, schlendern, fahren, sich begeben, sich auf den Weg machen, sich auf die Socken machen, zum Beispiel Sie geht heute in die Stadt oder er fährt morgen aufs Land. Andere Belege:
[www.geoclub.de, Dezember 2008]
Viele Zuhörer schlendern nach draußen, gucken sich lieber an den Büchertischen und PDS- Ständen in der Vorhalle um, trinken Bier, essen Wurst und strömen erst wieder in die Halle, als eine weitere "Gesprächsrunde" ankündigt wird.
[die tageszeitung, 31.10.1990, S. 7]
Die meisten Präpositionen sind für diesen Wohin-Kontext geeignet, zum Beispiel:
- Ich gehe aufs Postamt.
- Ich gehe bis Santiago de Compostela.
- Ich gehe hinters Haus.
- Ich gehe in die Schule.
- Ich gehe nach Paris.
- Ich gehe unter die Leute.
- Ich gehe vors Haus.
- Ich gehe zu meiner Großmutter.
- Ich gehe zwischen die Beete.
Welche Präposition wählen wir für unseren Wohin-Kontext?
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen speziellen und vagen Präpositionen.
Spezielle Präpositionen
Die meisten Präpositionen sind spezielle Präpositionen. Mit speziellen Präpositionen wie vor, neben oder in legen wir ganz speziell fest, wie die Bewegung ausgeht: Am Ende meiner Bewegung stehe ich vor dem Haus oder zwischen den Beeten. Ich begebe mich unter die Leute, also mitten hinein.
So gehen wir zum Beispiel auch speziell an Gewässer — es sei denn, wir gehen baden oder laufen Schlittschuh...
| Gewässer | |
| an | Ich fahre .... an den Rhein .... an den Rio Grande .... an den Ammersse .... ans Mittelmeer .... an den Pazifischen Ozean |
[die tageszeitung, 5.10.1999, S. 19]
Arnold Höllriegel, der eigentlich Richard A. Bermann hieß, war ein Weltreisender, wie es nur wenige gab zu seiner Zeit. In Indien kannte er sich ebenso aus wie in Wien oder in Afrika. Und wer das "Berliner Tageblatt" las, der kam mit ihm nach Palästina und an den Amazonas, er sah Ägypten und die lybische Wüste, bisweilen auch die Berliner Vorstädte.
[Frankfurter Allgemeine 1995, o.S.]
Zum Beispiel vor drei Jahren: Da lasen wir eine tolle Reportage über Slowenien und Kroatien - packten unsere Koffer und fuhren an die Adria.
[Die Zeit, 27.12.2001, S. 58]
Speziell ist auch die Präposition auf. Wer auf den Berg geht, ist am Ende seiner Bewegung oben auf dessen Gipfel. Mit auf verbinden wir auch Verben, die eine heftige, überwältigende, gewaltsame Bewegung ausdrücken. Heftige Bewegungen wirken offenbar so auf uns, als würden sie erst irgendwo ganz oben enden. So marschieren wir aufs Rathaus, das heißt: nehmen es ganz und gar bis unters Dach ein, oder stürmen auf das Rednerpult:
[Die Presse, 13.03.1998, o.S.]
Besonders Deutschlerner verblüfft immer wieder, dass man im Deutschen auch auf die Sparkasse geht. Damit will niemand aussagen, dass sich einer aufs Dach der Sparkasse begibt; gesagt wird lediglich, dass einer in die Sparkasse hineingeht, um seine Angelegenheiten zu regeln. Auch wer auf die Uni geht, steigt nicht auf das Dach des Universitätsgebäudes, sondern besucht die Institution regelmäßig als Student.
[die tageszeitung, 26.8.1989, S. 16]
Hätte man wie früher grosse Fabriken, könnte ja mein Ältester statt aufs Gymnasium in die Fabrik zum Arbeiten gehen.
[St. Galler Tagblatt, 6.5.1998, o.S.]
Für spezielle Kontexte brauchen wir also spezielle Präpositionen: Wenn wir betonen möchten, dass wir vor das Haus gehen, werden wir die Präposition vor wählen und nicht vage sagen, dass wir zum Haus gehen.
Vage Präpositionen
Mit vagen Präpositionen wie zu können wir relativ offen lassen, wo sich jemand nach seiner Wohinbewegung befindet: Wenn ich zum Rathaus gehe, muss ich nicht unbedingt auch hineingehen. Ich kann mich abschließend vor dem Rathaus, neben dem Rathaus oder hinter dem Rathaus befinden und dort auf jemanden warten. Vage Präpositionen geben eine ungefähre Richtung an, bestimmen also das Verhältnis zwischen den Sachen nur ungefähr und lassen das Resultat weitgehend unbestimmt. Das macht vage Präpositionen vielseitig einsetzbar. Ich kann zum Rathaus, zum Amazonas und zu meiner Großmutter fahren.
[Goethe: Die Leiden des jungen Werther (1787). In: Goethes Werke, Bd. 6, 1982, S. 117]
In vielen Kontexten kann man verschiedene Präpositionen verwenden. Im Laufe unserer Sprachgeschichte haben sich allerdings bestimmte Präpositionen für bestimmte Kontexte etabliert.
Wohin: Geografische Namen
So kombinieren wir geografische Namen meist mit dem vagen nach, mitunter aber auch mit dem speziellen in: nach Frankreich, in die Schweiz. Dabei gilt als Faustregel, dass geografische Namen, die für gewöhnlich ohne Artikel verwendet werden (Frankreich ist ein amüsantes Land), ein nach haben, geografische Namen mit Artikel dagegen (Die Schweiz ist ein amüsantes Land) ein in. Daraus folgt auch, dass Städtenamen mit nach verbunden werden: nach Paris; Namen von Gegenden, von Gebirgen und so weiter dagegen mit in: ins Elsaß, denn wir verwenden Städtenamen meist ohne Artikel (Paris ist eine amüsante Stadt), Gegenden, Gebirge und so weiter meist mit Artikel (Das Elsaß ist eine amüsante Gegend).
| Ländernamen | Städtenamen | Namen für Gegenden, Gebirge usw. | |
| nach | Ich fahre .... nach Frankreich .... nach Deutschland .... nach Pakistan .... nach Indien .... nach China .... nach Marokko | .... nach Paris .... nach Köln .... nach Islamabad .... nach Mumbai .... nach Beijing .... nach Marrakesch | |
| in | .... in die Schweiz .... in die Niederlande .... in die Slowakei .... in die Vereinigten Staaten .... in den Sudan | .... ins Elsaß .... in die Alpen .... ins Engadin .... in den Himalaya .... ins Rifgebirge |
[St. Galler Tagblatt, 20.01.1998, o.S.]
In Lissabon muß darob der junge Redakteur Firmino, der lieber seine Studie über den "Einfluß Vittorinis auf die portugiesische Nachkriegsliteratur" schreiben würde, die Koffer packen und nach Porto fahren, um seiner Boulevardzeitung ein paar sensationelle Berichte zu liefern.
[Die Presse, 11.10.1997, o.S.]
Zum Akklimatisieren entschied die Gruppe, zuerst einen 4000er zu bezwingen. Und fuhr ins Shemshak-Gebiet. "Das Skigebiet der Teheraner", sagt Ehrengruber.
[Oberösterreichische Nachrichten, 9.10.1997]
Er und sein langjähriger Bergspezi Willi Schweitzer waren auf dem Heimweg vom berüchtigten Glocknerrennen über die Pfandlscharte ins Käfertal abgefahren.
[Salzburger Nachrichten, 30.5.1992, o.S.]
In unkonventionellen Kontexten wird auch mal kreativ variiert:
[Udo Lindenberg: "Reggae Meggi", 1976, zitiert nach: songkorpus.de]
Wohin: Gebäudebezeichnungen
Bezeichnungen für Gebäude, Institutionen usw. werden mit zu kombiniert.
| Gebäudebezeichnungen | |
| zu | Ich fahre .... zum Rathaus .... zum Supermarkt .... zum Stehimbiss .... zum Museum .... zur Sparkasse |
[die tageszeitung, 31.03.2005, S. 14]
Erhobenen Hauptes reiße ich mich von Dosenbier und BRD -Italien los, laufe zum Kiezpalast, im sicheren Bewußtsein, ideologisch auf der richtigen Seite zu stehen.
[die tageszeitung, 2.7.1988, S. 29]
In vielen Fällen können wir aber auch hier das speziellere in verwenden. Als Faustregel gilt, dass in mit allen Bezeichnungen für konkrete Räume kompatibel ist: Ich gehe ins Institut für Deutsche Sprache, ins Rathaus, in die Sparkasse.
[Die Zeit, 31.1.1997, S. 84]
Herausforderungen hat Zich immer gesucht. "Mit fünf bin ich jeden Tag in die Schule gerannt und hab mich einfach reingesetzt."
[Salzburger Nachrichten, 26.06.1999, o.S.]
Nicht kompatibel ist in dagegen mit Bezeichnungen für abstrakte Institutionen. Schief ist etwa Ich laufe heute *in VW, *in Mercedes, *in die Mannheimer Verkehrsvereinigung oder *in die Unicef - jedenfalls wenn wir von konkreten Bewegungen sprechen. Bezeichnungen für Institutionen, also Körperschaften, werden grammatisch offenbar genauso behandelt wie Bezeichnungen für körperliche Personen.
Wohin: Personenbezeichnungen
Personenbezeichnungen kombinieren wir in vagen Wohin-Kontexten mit zu.
| Personenbezeichnungen | |
| zu | Ich fahre .... zur Großmutter .... zum Bäcker .... zu Herrn Müller .... zu Tante Martha |
[Die Zeit 8.11.1997, S. 57]
Auf der Straße hielten mich zwei Matrosen an, beide waren schon reichlich angesäuselt, und einer von ihnen, so ein blonder, schweinswimpriger Kerl, wollte wissen, wo es zu »Tante Paula« ging.
[Siegfried Lenz: Die Klangprobe. Roman. In: Werkausgabe in Einzelbänden, Bd. 11, S. 458]
Oft hört man als umgangssprachliche Variante auch bei, zum Beispiel:
[Kinderbuchrezension 2003 in http://www.restena.lu]
Plötzlich merkten Schneeweißchen und Rosenrot, dass Sie die Nacht an einem tiefen Abgrund lagen und hätten hineinfallen können. Was sie doch für ein Glück gehabt haben und gingen bei die Mutter nach Hause.
[Filmrezension 2008 in http://www.film-dvd-shop.de]
Spezielle Wohinkontexte können wir außerdem durch die speziellen Präpositionen ausdrücken. Wenn möglich, vermeiden wir, über Tante Martha zu fahren. Vgl. auch Umfährt er ihn oder fährt er ihn um? — Verbkomposita und Präverbfügungen. Aber wenn man Science-Fiction-Filmen glauben darf, werden wir bald als miniaturierte Menschlein in Tante Martha fahren können.
Nach Aldi
[Die Zeit 20.9.2000, o.S.]
»Die Kölner nehmen das Hochwasser mit Humor. Die kennen das eben schon«, berichtet der Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma, der sich gerade ein Bild von den Überschwemmungen im Kölner Stadtteil Rodenkirchen gemacht hat. »Als wir mit einer Barke durch die Fluten fuhren, rief uns ein Mann zu: Nehmt ihr mich mit nach Aldi?«
[Grenz-Echo, 06.01.2003, o.S.]
Eine vage Präposition ist auch nach. Sie wird mitunter alternativ zur vagen Präposition zu verwendet. Zumindest liest man immer mal wieder in Grammatiken, dass es Ausnahmen der Art nach Aldi, nach Lidl, nach dem Bahnhof gebe. Der Duden 2005 vermutet: "Auf das Norddeutsche beschränkt und damit nicht standardsprachlich ist nach in der Bedeutung 'zu': nach dem Bahnhof gehen". Der Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA) präzisiert: "Wo gehen Sie hin? Gefragt war im Beispielsatz nach der Verwendung von Präpositionen bei Namen von Supermärkten. So sagt man in Norddeutschland überwiegend: Ich gehe zu Aldi/Lidl. Im Ruhrgebiet, im nördlichen Rheinland, im Westmünsterland und in Ostfriesland geht man oft auch nach Aldi/Lidl (vgl. ndl. naar ...). In der Schweiz geht man teilweise auch in (den) Lidl/Aldi. Im restlichen deutschen Sprachgebiet geht man meist zum Aldi/Lidl. Auch hier gibt es eine Luxemburger Variante: Ich gehe bei Lidl/Aldi."
Aufgeschriebene Belege dafür finden sich allerdings selten: So beinhalten die IDS-Korpora der geschriebenen Sprache mit mehreren Milliarden laufender Wörter die Wortfolge nach dem Bahnhof zwar ca. 1000 Mal (Stand 2024, z. B. Vor und nach dem Bahnhof werden diese Straßen von Stadtbahngleisen mittels offenliegender Brücken überquert), das Dudenbeispiel im betreffenden Wohin-Kontext jedoch nur vereinzelt:
[St. Galler Tagblatt, 23.09.2009, S. 43]
Und sogar im Internet, in dem sich ja bekanntlich alles findet, lassen sich Belege für die räumliche Lesart kaum belegen:
[http://www.blautor.de, Dezember 2008]
Sie gingen nach dem Bahnhof, um den älteren Bruder Kurt abzuholen, der seit einigen Monaten in Heidelberg die Rechte studierte und nun zum Ferienbesuch kam.
[Schmitz 1925, http://gutenberg.spiegel.de]
Auch mit geografischen Namen wird nach kaum kombiniert. Hier einige der raren, regional allerdings nicht eindeutigen Belege:
[die tageszeitung, 04.06.1991, S. 8]
Ein wichtiger Teil der in Deutschland konfiszierten «entarteten Kunst» wurde von offiziellen Zwischenhändlern direkt und wiederum zu einem grossen Teil nach den Vereinigten Staaten verkauft.
[St. Galler Tagblatt, 22.5.1998, o.S.]
Sobald er schlecht und recht mit dem langweiligen Humanismus zu Rande gekommen sein würde, wollte er das Polytechnikum beziehen und, so plante er, später zu weiterer Ausbildung nach England oder auch gleich ins Dorado der Technik, nach den Vereinigten Staaten gehen.
[Thomas Mann: Die Betrogene 1953. In: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Bd. 8. Frankfurt 1960, S. 894]
Nur die reichen Bürger Kinshasas haben sich nach dem Kongo abgesetzt, der nur eine Bootsfahrt über den Fluß entfernt ist.
[Frankfurter Allgemeine, 14.5.1997, o.S.]
Selbst das berühmte nach Aldi kommt fast ausschließlich im Kontext des bekannten Witzes vor; die meisten Belege haben erst gar keinen Wohin-, sondern einen anderen Kontext, etwa die drittstärkste Marke nach Aldi. Auch Internetforen ergeben zahlreiche Treffer, nämlich dort, wo heftig diskutiert wird, ob es zu Aldi oder nach Aldi heißen "muss", etwa in www.wer-weiss-was.de, in www.stanger.org oder in www.gutefrage.net.
Immerhin scheint nach Ikea gesamtdeutsch etabliert, offenbar unter Ikea-Kunden sogar Kult. Zwar findet es sich in den IDS-Korpora der geschriebenen Sprache nur fünfmal (und das ausschließlich in Twitter- bzw. YouTube-Belegen), aber insgesamt recht häufig im Internet. Eine Bloggerin aus Essen bekennt:
[www.qype.com,Dezember 2008]
Und in einem Online-Artikel der FAZ heißt die Headline:
Von Karsten-Thilo Raab [http://www.faz.net, Juni 2007]
Zum Text
- Schlagwörter
- Autor(en)
- Elke Donalies
- Bearbeiter
- Roman Schneider
- Letzte Änderung
- Aktionen
-
Seite merken
Seite als PDF
Seite drucken
Seite zitieren
- Seite teilen