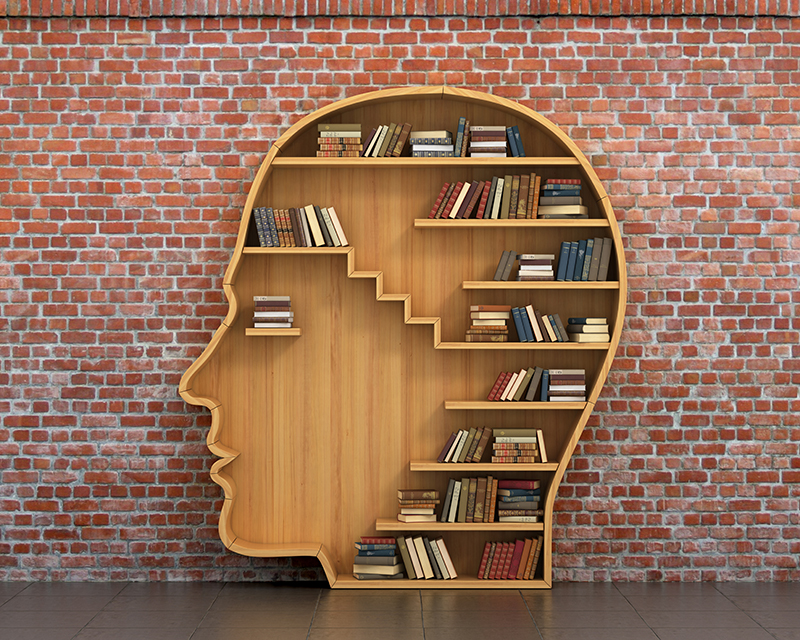Grammatik in Fragen und Antworten

Kann der Chefarzt eine Ärztin sein? — Das generische Maskulinum und seine Tücken
In der Diskussion über das generische Maskulinum stoßen oft kontrovers diskutierte Meinungen aufeinander, und auch innerhalb der Sprachwissenschaft gibt es unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema. Für die einen ist das generische Maskulinum eine wichtige und hilfreiche Form, um ökonomisch zu kommunizieren, weil es Menschen aller Geschlechter einschließe. Für die anderen birgt es zum einen kommunikative Schwächen, da nicht in allen Kontexten ersichtlich sei, ob mit einer maskulinen Bezeichnung (Händler, Sportler, Preisträger etc.) nur Männer gemeint sind oder Menschen aller Geschlechter, zum anderen ließe es den Respekt gegenüber Menschen anderer Geschlechtsidentitäten vermissen. Zu diesem vor allem sprachpolitisch hoch umstrittenen Thema liegen mittlerweile zahlreiche (Fach-)Publikationen vor, die in ihrer Einschätzung durchaus zu unterschiedlichen (und jeweils linguistisch fundierten) Ergebnissen kommen.
Nicht immer besteht das Bedürfnis, explizit von männlichen oder weiblichen Personen zu sprechen; oft wird nur an Menschen an sich oder an eine bestimmte Gruppe gedacht. Hier ist das (generische) Maskulinum traditionell das Mittel der Wahl:
Wenn dagegen individuelle Personen gemeint sind, geht es auch um sprachliche Präzision und um Respekt. Hier wird häufig das Genus benutzt, das dem biologischen Geschlecht entspricht, wenn eine solche (z. B. movierte) Form zur Verfügung steht:
Diese Tatsache hat nichts damit zu tun, dass das grammatische mit dem biologischen Geschlecht verwechselt würde, vielmehr sollen (konkrete) einzelne Personen angemessen und korrekt adressiert werden. Allerdings funktioniert dies nur innerhalb des binären Systems von männlich und weiblich – Menschen anderer Geschlechtsidentitäten werden hier nicht explizit erfasst.
Was unterscheidet das grammatische vom biologischen Geschlecht?
- Alle Nomina, sowohl Personenbezeichnungen als auch Nichtpersonenbezeichnungen, haben ein grammatisches Geschlecht, das Genus. Im Deutschen gibt es drei Genera:
- Maskulinum (der Mann, der Wald, der Friede)
- Femininum (die Frau, die Wolke, die Freude)
- Neutrum (das Kind, das Haus, das Verlangen)
- Alle Menschen haben ein biologisches Geschlecht, den Sexus. Es gibt biologisch männliche und weibliche Personen sowie Menschen, die sich nicht eindeutig einem dieser beiden prototypischen Geschlechter zuordnen lassen. Auch muss das biologische Geschlecht nicht mit demjenigen übereinstimmen, mit dem sich ein Mensch identifiziert – hier steht die neurobiologische Forschung noch am Anfang.
- Hinzu kommen weitere Faktoren wie das soziale Geschlecht (etwa stereotype Rollenbilder), die zumindest grammatisch/orthografisch weniger relevant sind.
Grammatisches und biologisches Geschlecht stimmen im Deutschen meist (der Vater, der Neffe; die Mutter, die Nichte), jedoch nicht immer überein: So meinen wir zwar in der Regel mit der Unhold einen Mann und mit die Hexe eine Frau; dagegen wird mit die Memme meist ein Mann bezeichnet, mit der Blaustrumpf eine Frau. Klarer ist dies, wenn es sowohl eine maskuline als auch eine feminine Form gibt, dann wird in der Regel auch entsprechend referiert: Gekommen sind eine Juristin und ein Arzt. Vgl. ausführlich Genus und Sexus.
Spätestens seit den Emanzipationsbewegungen der 1970er-Jahre wird eine sexusspezifische Verwendung bei solchen paarigen Ausdrücken vorgeschlagen, die sowohl eine maskuline als auch eine feminine Form haben, wie der Bürger / die Bürgerin etc. Daher sind Anreden wie „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“ oder „Liebe Kolleginnen und Kollegen“ heute eher der Regel- als der Ausnahmefall; vgl. auch Frau Professor oder Frau Professorin? Einige psycholinguistische Studien kommen zum Schluss, dass in manchen Situationen vor dem inneren Auge nicht Männer und Frauen gleichermaßen erscheinen, wenn mit dem generischen Maskulinum formuliert wird. Beidnennungen sollen deshalb zu sprachlicher Gleichberechtigung beitragen — auch wenn sie nur für das binäre System zutreffen (s.o.).
Eine Fokussierung auf männliche Personen erfolgt besonders bei Singularformen und vor allem dann, wenn auf eine konkrete Person referiert wird: Wenn also vom Chefarzt einer Klinik gesprochen wird, aber eine Ärztin gemeint ist, führt dies fast zwangsläufig zu Missverständnissen, zumindest aber zu Uneindeutigkeit: Die überwiegende Mehrzahl der Menschen scheinen dann — so psycholinguistische Tests — an einen Mann zu denken. Eine solche referenzierende Bezeichnung verstößt gegen das grundlegende Kommunikationsprinzip der Verständlichkeit und der Vermeidung von Mehrdeutigkeit. Denn in vielen Situationen, in denen für Personenbezeichnungen sowohl eine feminine als auch eine maskuline Form existiert, ist das generische Maskulinum nicht ausreichend spezifisch, so in Stellenanzeigen. Wenn etwa in Kitas mehr „Erzieher“ gesucht werden, stellt sich die Frage, ob es allgemein um mehr Personal geht oder darum, den Kindern mehr männliche Bezugspersonen zur Verfügung zu stellen. Daher sollte in jeder Kommunikationssituation und in jedem Text abgewogen werden, ob ausschließlich geschlechtsübergreifende Informationen vermittelt werden sollen oder ob im Sinne von gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung auch das biologische Geschlecht relevant sein könnte.
Auswirkungen auf die Sprachpraxis
Für Berufsbezeichnungen in Stellenausschreibungen ist seit 2006 im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verbindlich geregelt, dass diese explizit alle Menschen ansprechen sollen, sie dürfen also nicht nur im Maskulinum formuliert sein. Allein das belegt, dass der Anspruch, den das generische Maskulinum traditionell hat, sich an alle in Frage kommenden Personen zu richten, in der Praxis nicht jederzeit zutrifft. Dies war nicht immer der Fall. Lange Zeit wurden Berufsbezeichnungen mehr oder weniger automatisch als generische Maskulina aufgefasst: der Arzt, der Lehrer, der Schreiner, der Bäcker, der Chemiker, der Pilot, der Wissenschaftler. Das zeigt sich immer noch in ritualisierten Ausdrücken wie zum Arzt gehen oder beim Bäcker einkaufen, mit denen nicht die Personen, sondern die Berufsgruppe gemeint ist. Solche Fälle sind allerdings anders gelagert als echte generische Ausdrücke — bei den meisten Berufsbezeichnungen gibt es feminine Entsprechungen: die Ärztin, die Bäckerin, die Lehrerin, die Schreinerin usw. Das unterscheidet sie von genuin generischen Ausdrücken wie die Person oder der Mensch, zu denen es keine movierten Formen gibt.
Da im Deutschen Personenbezeichnungen auf „-er“ systematisch feminine Formen auf „-in“ bilden, wird die maskuline Form inzwischen mindestens als uneindeutig, wenn nicht (je nach Zusammenhang) als unpassend angesehen, wenn sie auch auf Frauen referieren soll. Das wird nicht erst von der feministischen Linguistik so gesehen; vielmehr bezeichnet es bereits der Sprachkritiker Gustav Wustmann (1896 in seinen "Allerhand Sprachdummheiten" und in Folgeauflagen) als „großen Unsinn“, bei weiblichen Personen nicht von „Arbeiterinnen“ oder „Lehrerinnen“ zu sprechen, sondern von „weiblichen Arbeitern oder Lehrern“. Für Chefarzt bedeutet dies konkret, dass (je nach Kontext) entweder die Beidnennung genutzt werden kann (der Chefarzt / die Chefärztin) oder eine neutrale Form (Ärztliche Leitung). Ist jedoch bekannt, dass es sich bei der Person um eine Frau handelt, sollte auch explizit von der Chefärztin gesprochen werden.
Nicht regelkonform sind schriftliche Formen mit Binnenmajuskel (ChefärztIn) oder Sonderzeichen im Wortinneren (Chefärzt*in), auch wenn sie in inoffiziellen Kontexten zu finden sind (vgl. Sonderzeichen-Passus ARW 2024, S. 153/54). Diese Sonderzeichen dienen dem Bemühen, Menschen jenseits des binären Systems, das nur zwischen männlich und weiblich unterscheidet, geschlechtssensibel bezeichnen und ansprechen zu können. Spätestens mit den höchstrichterlichen Urteilen zu Änderungen im Personenstandsregister in Deutschland (2017), Österreich (2018) und Belgien (2019) wurde klargestellt, dass auch Menschen anderer Geschlechtsidentitäten ein Recht auf adäquate Bezeichnungen haben, die aber die deutsche Sprache — außer durch Bezeichnungen wie oben Ärztliche Leitung — traditionell oft nicht bereithält. Hier ist die Sprachgemeinschaft noch auf der Suche nach Lösungen.
Literatur in Auswahl
Diewald/Nübling 2022, Diewald/Steinhauer 2022, Doleschal 2002, Irmen/Steiger 2005, Krome 2021, Müller-Spitzer 2021
Zum Text
- Schlagwörter
- Autor(en)
- Sabine Krome
- Letzte Änderung
- Aktionen
-
Seite merken
Seite als PDF
Seite drucken
Seite zitieren
- Seite teilen