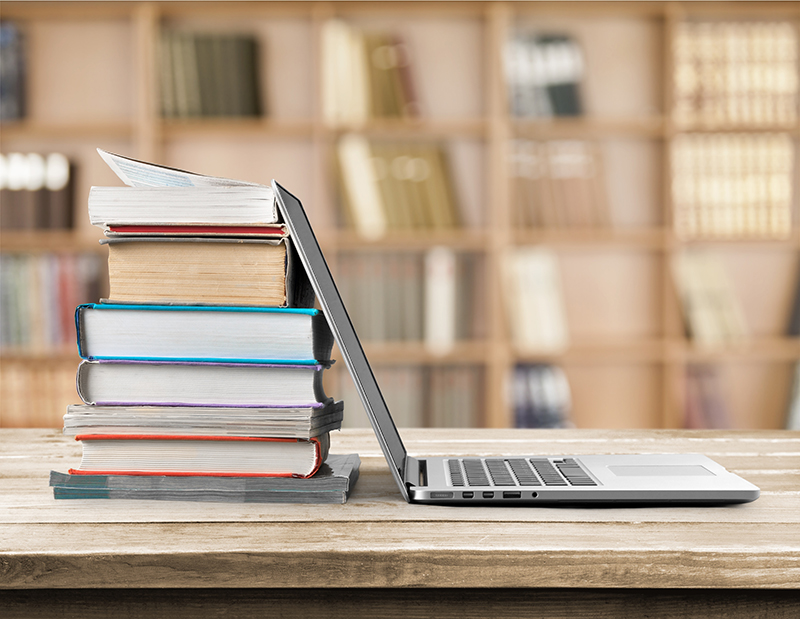Genus und Sexus
Genus und Sexus gelten als die zentralen Begriffe in der Diskussion um einen geschlechtssensiblen Sprachgebrauch, womit sowohl die angemessene Bezeichnung als auch eine entsprechende Adressierung von Personen jeglicher Geschlechtsidentität gemeint ist. Da Sprache verschiedene Ebenen der Lebenswirklichkeit abbildet (biologisch, soziologisch, soziopsychologisch u. a.), stellt sich die Frage, was genau wie präzise bezeichnet wird. Im Kern geht es darum, wie weit das (grammatische) Genus und der (biologische) Sexus des Menschen in Benennungen für einzelne Personen zusammenhängen und wo die Unterschiede liegen.
Der Unterschied zwischen Genus und Sexus
- Alle Nomina, sowohl Personenbezeichnungen als auch Nichtpersonenbezeichnungen, haben ein grammatisches Geschlecht, das Genus. Im Deutschen gibt es drei Genera:
- Maskulinum (der Mann, der Wald, der Friede)
- Femininum (die Frau, die Wolke, die Freude)
- Neutrum (das Kind, das Haus, das Verlangen)
- Alle Menschen haben ein biologisches Geschlecht, den Sexus. Es gibt biologisch männliche und weibliche Personen sowie Menschen, die sich nicht eindeutig einem dieser beiden prototypischen Geschlechter zuordnen lassen. Auch muss das biologische Geschlecht nicht mit demjenigen übereinstimmen, mit dem sich ein Mensch identifiziert – hier steht die neurobiologische Forschung noch am Anfang.
- Hinzu kommen weitere Faktoren wie das soziale Geschlecht (etwa stereotype Rollenbilder), die zumindest grammatisch/orthografisch weniger relevant sind.
Die Termini, mit denen die Kategorie Genus beschrieben wird, spiegeln bereits wider, dass die Benennung ursprünglich durchaus einen Zusammenhang zwischen Genus (lat. genus ‚Geschlecht, Gattung, Art‘) und Sexus (lat. sexus ‚Geschlecht des Menschen‘) herstellt: So leitet sich der Terminus Maskulinum von lat. masculus ‚Mann/Männchen‘ her, der Terminus Femininum von lat. femina ‚Frau/Weibchen‘, der Terminus Neutrum ist zu lat. neuter ‚keiner von beiden‘ gebildet. Dass jedoch nicht grundsätzlich eine Übereinstimmung in dieser Hinsicht besteht, liegt auf der Hand – bezeichnen zahlreiche Nomina doch neben Lebewesen auch Dinge und Abstrakta, die kein natürliches Geschlecht aufweisen, also weder männlich noch weiblich sind (der Frieden, die Welt, das Feld).
Aber auch bei den Bezeichnungen für Menschen stimmen Genus und Sexus nicht durchgängig überein, denn die meisten maskulinen Benennungen von Personen werden traditionell sowohl für männliche als auch für weibliche Menschen verwendet:
Man spricht hier vom „generischen Maskulinum“, das auch geschlechtsübergreifend genutzt wird; dies gilt vor allem für Bezeichnungen von Berufsgruppen oder Institutionen sowie für feste Wendungen (zum Arzt/Bäcker gehen). Aber auch feminine Bezeichnungen können mitunter (vorrangig) männliche Personen meinen (die Ordonanz, die Memme) und maskuline (der Blaustrumpf, der Backfisch) oder neutrale (das Mädchen, das Weib) Bezeichnungen ausschließlich weibliche. Siehe dazu ausführlicher Generische Genera.
Hauptmittel sexusorientierter Referenz im Deutschen ist also offenbar weniger das Genus als die Movierung, wenn sie denn möglich ist. So wird mit die Studentin explizit eine weibliche Person, die studiert, bezeichnet, mit der Hexerich explizit eine männliche Hexe (viele maskuline Movierungen mit femininem Grundwort gibt es allerdings nicht). Besonders deutlich wird die spezifische Funktion der Movierung, wenn aus einer femininen Bezeichnung wie die Ratte eine Bezeichnung wie die Rättin moviert wird, die explizit etwas biologisch Weibliches ausdrückt. Beides ist jedoch in der Alltagskommunikation wenig verbreitet, vielmehr sind solche Wortbildungen vorwiegend literarisch belegt. Siehe dazu Genus und Movierung.
Der Zusammenhang zwischen Genus und Sexus
Genus und Sexus sind also klar zu trennen. Ersteres ist eine grammatische Kategorie, das andere eine biologische Einteilung. Dennoch gibt es Zusammenhänge, da Personen im Deutschen meist entsprechend ihrem biologischen Geschlecht mit Ausdrücken des dazu passenden grammatischen Genus bezeichnet werden: männliche Personen mit maskulinen Ausdrücken (der Vater, der Neffe, der Lehrer), weibliche Personen mit femininen (die Mutter, die Nichte, die Lehrerin).
Abweichungen davon sind in gesellschaftlichen Kontexten aufschlussreich: Interessant sind dabei Untersuchungen zum Zusammenhang von Genus und Sexus, die gerade auf Verstöße gegen erwartete Geschlechterrollen (das soziale Geschlecht) hinweisen und zeigen, dass in bestimmten Kontexten mit der Wahl des Genus bewusst abwertende Zuweisungen einhergehen können: Homosexuelle Männer werden dann beispielsweise in pejorativer Absicht mit Feminina bezeichnet (die Tunte, die Schwuchtel) und Frauen, die nicht den an sie gestellten Erwartungen entsprechen, mit Maskulina (der Vamp) oder Neutra (das Luder, das Weib).
Je nachdem, wie stark der Zusammenhang zwischen Genus und Sexus bei Personenbezeichnungen gewichtet wird, kommt es zu unterschiedlichen Beurteilungen in Bezug auf das generische Maskulinum: Ist es tatsächlich generisch, schließt es also alle Sexus ein? Ist es problematisch, weil nicht eindeutig? Ist es praktisch oder ist es diskriminierend? Insgesamt ist die kontroverse Diskussion um den Zusammenhang von Genus und Sexus in Bezug auf Personen in Entwicklung begriffen und den zahlreichen Studien, die seit dem Einsetzen der empirischen Wende in der Linguistik (etwa um die Jahrtausendwende herum) vorgenommen wurden, werden noch weitere folgen.
Bei der Diskussion des Themas spielt auch die Umsetzung im Bereich der Orthografie eine wesentliche Rolle. Besonders kontrovers diskutiert werden in diesem Zusammenhang verkürzende Sonderzeichen im Wortinneren (Lehrer:innen, Kolleg*innen) zur Bezeichnung verschiedener Geschlechtsidentitäten, die in Grammatik und Orthografie systemlinguistische Folgeprobleme verursachen können.
Literatur in Auswahl
Diewald/Nübling 2022, Doleschal 2002, Eisenberg 2019, Kotthoff/Nübling 2018, Krome 2020, Müller-Spitzer 2021, Nübling 2020, Thurmair 2006, Zifonun 2021
Weitere einschlägige Literatur in der "Bibliografie zur deutschen Grammatik"