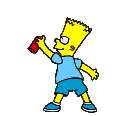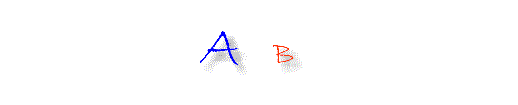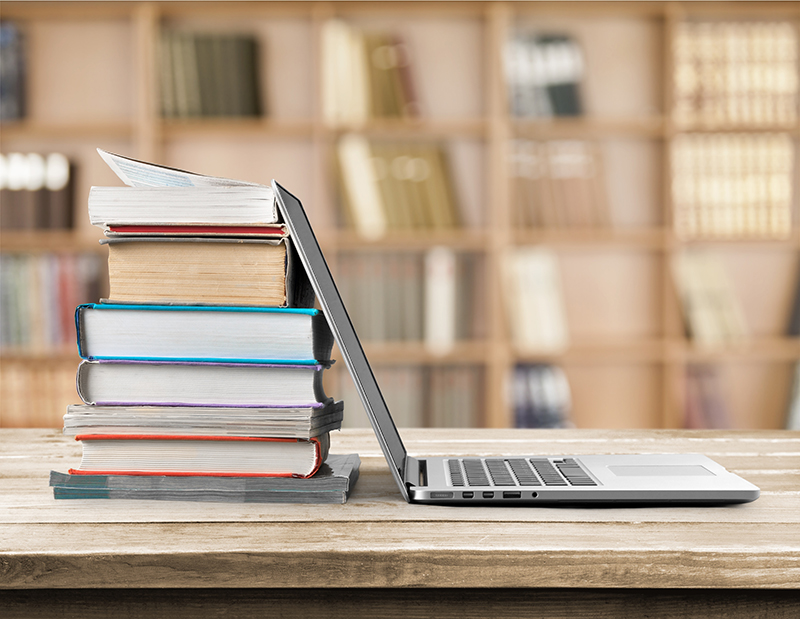Genus Verbi: Aktiv und Passiv
Was war hier zu sehen?
Wer den
Knaben kennt, wird vielleicht sagen: "Bart hat etwas an eine Wand gesprüht." Wer nicht weiß,
wer hier mit der Sprühdose am werken ist, braucht sich dazu nicht zu äußern und kann einfach
feststellen: "Hier ist etwas an eine Wand gesprüht worden."
Als geübter Sprachbenutzer greift man ganz selbstverständlich zu solchen Formulierungen, ohne darin etwas Besonderes zu erkennen. Dabei liegt es keineswegs einfach in der Natur der Sache, dass derart verschiedene Darstellungen möglich sind. Anders als im Satz könnte in einem Bild der Knabe nicht ausgeblendet werden, ohne dass damit ein grundsätzlich anderer Sachverhalt dargestellt würde.
Die Sprache erlaubt, Informationen über Sachlagen in einer Weise zu filtern und zu arrangieren, die mit grafischen Mitteln nicht nachzuvollziehen ist. Möglich wird dies, weil sprachliche Darstellungen Sachverhalte nicht einfach widerspiegeln oder - wo solche nicht wirklich gegeben sind - vorspiegeln, sondern sie in Bestandteile auflösen, denen in der optischen Wahrnehmung keine isolierbaren Einheiten entsprechen: in Gegenstände, Eigenschaften und Beziehungen.
Die Auflösung von Sachverhalten in solche Bestandteile dient dazu, mit endlich vielen sprachlichen Mitteln unbegrenzt viele Sachverhalte fassbar zu machen. Zugleich eröffnet sie die Möglichkeit, ein und denselben Sachverhalt in regelhafter Weise verschieden zu erfassen, denn grundsätzlich lässt sich jede Beziehung zwischen Gegenständen auf verschiedene Weisen beschreiben.
Hier kann man feststellen:
"A überragt B", aber ebenso: "B wird von A
überragt."
Allerdings findet bei weitem nicht alles, was verschieden zu fassen wäre, auch verschiedenen sprachlichen Ausdruck. Insbesondere sind nur wenige solcher konversen Beziehungen mit verschiedenen lexikalischen Mitteln auszudrücken, etwa kaufen - verkaufen, geben - erhalten.
Realisiert werden nur Konversen, mit denen wichtige Unterschiede bei der Darstellung einer Sachlage zum Ausdruck zu bringen sind. Dies ist freilich weniger auf die Konversion selbst zurückzuführen als darauf, dass sie systematisch mit der Möglichkeit verbunden ist, ein wesentliches Element von Sachlagen bestimmter Art verschieden zu berücksichtigen.
Wer sich so äußert, erspart sich auszuführen, wer da demonstriert hat. Und selbst wenn man sich dies nicht ganz ersparen will, gelingt es doch, dieser Teilinformation ihr besonderes Gewicht zu nehmen, sie gewissermaßen zu marginalisieren:
Dem systematischen Charakter des Bedeutungsverhältnisses zwischen solchen Verben und ihren Konversen entspricht, dass die Konversion in weitaus den meisten Fällen nicht paarweise durch im Übrigen eigenständige Verben erreicht wird, sondern über Periphrasen, in denen das Partizip II eines Verbs zusammen mit einem Hilfsverb eingesetzt wird.
Verbformen, die mit einem dieser Hilfsverben und dem Partizip II eines Verbs zu bilden sind, gelten als Passiv-Formen, alle anderen Verbformen als Aktiv-Formen.
Die Bezeichnungen der beiden im Deutschen verfügbaren
Genera verbi als Aktiv und Passiv scheint deren Funktionen bei der sprachlichen
Erfassung von Sachverhalten auf den Punkt zu bringen: aktiv aus der Sicht von
Handelnden, passiv aus der Sicht jener, die von deren Aktionen betroffen
sind.
Tatsächlich ist bei Verwendung von Aktivformen die Position des Subjekts
häufig mit Ausdrücken besetzt, die Personen oder Institutionen bezeichnen, die im Sinn
des Verbs aktiv werden, während bei Passivformen in dieser Position häufig Bezeichnungen
für Personen oder allgemein Gegenstände stehen, die passiv dem Geschehen ausgesetzt
sind. Wörtlich nehmen sollte man diese Bezeichnungen freilich nicht, weil sie dann mehr
verwirren als erklären.
Verwirrend ist die Bezeichnung besonders bei Formen, die hier als subjektloses werden-Passiv bezeichnet werden. Hier ist ein Komplement, mit dem vom Geschehen Betroffene oder Betroffenes anzugeben wäre, gar nicht erst vorhanden.
(Berliner Zeitung 14.11.1997, 20)
(Berliner Zeitung 22.5.1998, 8)
Hinsichtlich Verbmodus, Numerus und Person verhalten sich Passivformen nicht anders als Aktivformen. Auch in den Tempusformen stimmen Aktiv und Passiv weitestgehend überein. Nur die beiden Formen des werden-Passivs zeigen bei der Bildung der komplexen Tempusformen Futurperfekt, Präsensperfekt, Präteritumperfekt eine Abweichung des Passiv-Hilfsverbs gegenüber der Formbildung bei dem entsprechenden Kopulaverb.
Der Film ist zu stark belichtet worden.
Die Besonderheiten der Genera verbi lassen sich am besten erfassen, wenn man sie im Kontrast beschreibt, denn, für sich betrachtet, ist jede Form, wie sie nun eben ist. Erst im Kontrast zeigt sich etwa, dass einem Komplement in der Aktivform ein anderes in der Passivform entspricht oder dort keine Entsprechung hat.
Aktiv und Passiv im Kontrast zu betrachten bedeutet nicht, eine Form als grundlegend zu betrachten und die andere aus ihr herzuleiten. Die Dynamik, die viele Beschreibungen der Beziehung zwischen beiden Genera verbi ins Spiel bringen - Das Akkusativkomplement wird zum Subjekt oder in einem ersten Schritt wird das Subjekt zum 'chômeur' - ist allein der Theorie geschuldet.
Zwar spricht einiges dafür, dass sprachgeschichtlich die Aktivformen älter sind, doch die historischen Prozesse sind bei der Erfassung der heutigen Verhältnisse nicht länger in Rechnung zu stellen, auch wenn sie im Sinn der Häckelschen These von der Rekapitulation der Phylogenese in der Ontogenese auch beim primären Spracherwerb wirksam werden sollten.
Die Genera verbi Aktiv und Passiv bilden ein ungleiches Paar
- Während jedes Verb im Deutschen über Aktivformen verfügt, finden sich ganze Klassen von Verben, die entweder überhaupt keine Bildung von Passivformen zulassen (etwa gelingen, entstehen, gleichen) oder nur in sehr speziellen Kontexten in solcher Form zu verwenden sind.
- Das Aktiv ist, wo überhaupt beide Optionen gegeben sind, eindeutig das Standard-Genus. Es stellt Sachlagen so dar, wie sie meist dargestellt werden sollen: mit Angabe aller Komplemente, die in der Valenz des verwendeten Verbs verankert sind, insbesondere mit Angabe dessen, was als Subjekt artikuliert wird und im Passiv ungenannt bleibt oder marginalisiert wird. Das Passiv kann entsprechend als markierte Form gelten.
- Wer über die Aktivformen verfügt, könnte als Sprecher oder Schreiber - prinzipiell - ganz auf entsprechende Passivformen verzichten, ohne gravierende Einschränkungen seiner Kommunikationsmöglichkeiten befürchten zu müssen. Ausschließlich mit Passivformen dagegen dürfte man sehr bald in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.
Während es nur ein Aktiv gibt, lassen sich im Passiv gleich drei Formen unterscheiden, von denen zwei auch noch zwei Unterarten aufweisen:
- das werden-Passiv mit den Unterarten werden-Passiv mit Subjekt und subjektloses werden-Passiv
- das sein-Passiv mit den Unterarten sein-Passiv mit Subjekt und subjektloses sein-Passiv
- das bekommen-Passiv
Da Aktiv und Passiv zur Erfassung identischer Sachverhalte eingesetzt werden können, ohne in jeder Hinsicht identische Darstellungen zu geben, sind auch semantische Aspekte der Aktiv-Passiv-Opposition und Aktiv und Passiv im Gebrauch von besonderem Interesse.