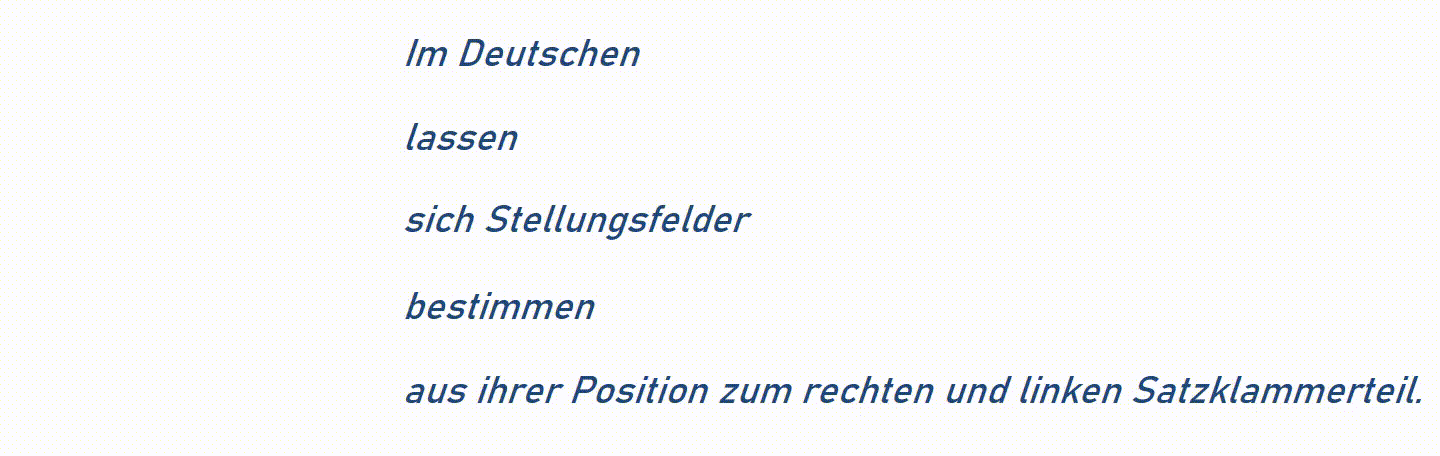Satzklammer und Stellungsfelder
Die Satzklammer teilt einen Satz in Stellungsfelder auf und kann deshalb gut zur Erklärung der Satzstruktur im Deutschen herangezogen werden.
Die Satzklammer besteht aus einem linken und einem rechten Teil. Der linke Satzklammerteil (lSkl) ist immer besetzt, der rechte (rSkl) je nach Satztyp obligatorisch oder fakultativ. Fakultativ ist er in Verberst- (1, 2, 3) und Verbzweitsätzen (4, 5) besetzt, obligatorisch in Verbletztsätzen (6, 7):
| lSkl | rSkl | ||||
| [1] | Holst | du mir bitte den Mantel? | — | ||
| [2] | Hast | du den Mantel | abgeholt? | ||
| [3] | Holst | du den Mantel | ab? | ||
| [4] | Gestern | war | ich in Köln. | — | |
| [5] | Er | hatte | — | gewusst, | dass sie in Köln war. |
| [6] | ... | , ohne dass | wir es | gemerkt hatten. | |
| [7] | Wer | es nicht | hat glauben wollen, | ... |
Die Beispiele (1) bis (5) zeigen, dass der linke Satzklammerteil in Verberst- und Verbzweitsätzen immer nur durch genau eine finite Verbform besetzt sein kann. In (6, 7) ist der linke Satzklammerteil durch ein einen Verbletztsatz einleitendes Element besetzt, das aber nicht immer aus nur einem Wort bestehen muss (6).
Die Besetzung des rechten Satzklammerteils ist komplexer und unterliegt bestimmten Abfolgeregularitäten. Ist er besetzt, wird er ausschließlich durch ein (2, 3, 5) oder mehrere verbale Elemente (6, 7), zu denen auch die Präverben ("trennbare Verbpräfixe") zählen (3), realisiert. Im Verbletztsatz bildet das einleitende Element den linken Klammerteil und der gesamte Verbalkomplex – also auch das finite Verb – den rechten.
In Verberst- und Verbzweitsätzen, in denen nur der linke Satzklammerteil realisiert ist (8), kann der fakultative – d. h. potenziell realisierbare – rechte Satzklammerteil als 'virtuell' bezeichnet werden. Seine Position ist fest, die Besetzung der Stellungsfelder bleibt von seiner Nicht-Realisierung bzw. Realisierung (durch die Bildung eines mehrteiligen Verbalkomplexes) unberührt (9):
| lSkl | rSkl | ||||
| [8] | Es | geriet | einiges aus den Fugen | — | in diesen Tagen. |
| [9] | Es | ist | einiges aus den Fugen | geraten | in diesen Tagen. |
Die Satzklammer wird gelegentlich auch als "Verbalklammer" oder "Satzrahmen" bezeichnet. Wir betrachten den Ausdruck „Satzklammer“ als angemessener, weil der linke Satzklammerteil nicht zwingend durch eine Verbform belegt sein muss:
| linker Satzklammerteil | rechter Satzklammerteil | |||
| Verberstsatz Verbzweitsatz | finite Verbform | … | (Partizip II, Infinitiv, Präverb) | |
| Verbletztsatz | Subjunktor, Relativ-Element | … | (Partizip II, Infinitiv), finite Verbform |
| lSkl = linker Satzklammerteil, rSkl = rechter
Satzklammerteil V-1 = Verberst-, V-2 = Verbzweit-, V-L = Verbletztsatz Vfin = finite Verbform, Vinf = infinite Verbform, V-L Einl. = Verbletztsatz einleitendes Element |
|
Stellungsfelder
Die drei Stellungsfelder Vorfeld, Mittelfeld und Nachfeld ergeben sich aus der relativen Position zum linken und rechten Satzklammerteil:
| Vorfeld | lSkl | Mittelfeld | rSkl | Nachfeld | |
| [10] | Der zweifache Europameister | hat | heute nicht so gut | gespielt | wie sonst. |
| [11] | Gestern | ist | er wesentlich schneller | gelaufen | als heute. |
| [12] | Unsere Mannschaft | siegt. | — | — | — |
| [13] | Er | reiste | letzten Dienstag | ab. | — |
| [14] | Wollen | sie morgen früh | abreisen? | — | |
| [15] | Mach | mal ein bisschen schneller! | — | — | |
| [16] | weil | er heute nicht so gut | gespielt hat | wie sonst. | |
| [17] | die | gestern in besserer Laune | gewesen ist. | — |
Vorfeld
Es ist nur in Verbzweitsätzen besetzt. Verberst- und Verbletztsätze verfügen über kein Vorfeld (vgl. (14)-(17) oben). Beispiel:
Mittelfeld
Dieses Stellungsfeld kann in allen Satztypen besetzt sein, was auch in den meisten Sätzen der Fall ist. Deshalb sind hier die Stellungsregularitäten besonders wichtig. Beispiele:
(20) Darf sich der Staat auf Geschäfte mit Kriminellen einlassen, um der Steuergerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen?
(21) Oder muss er ein paar Millionen sausen lassen, weil es die Moral gebietet? (heute.de, 01.02.2010)
Nachfeld
Dieses Stellungsfeld kann in allen Satztypen besetzt werden, auch wenn der rechte Satzklammerteil nicht realisiert ist. Beispiele:
(23) "Ich habe eigentlich das ganze Turnier über nicht so gut gespielt wie sonst." (Nürnberger Zeitung, 07.09.2007)
(24) "Die Spannung tut mir gut. Sie gibt mir die Energie, um gewinnen zu können. (die tageszeitung, 04.06.2005) []
(25) Was von dem, was dieser Präsident versprochen hat, konnte er erreichen in der eben neun Monate währenden Amtszeit? (zeit.de, 10.10.2009)
Im Unterschied zum Vorfeld in Verbzweitsätzen gilt das Nachfeld als strukturell fakultative Position (s. Wortstellung im Nachfeld). Seine Besetzung ist aber unabhängig vom Vorhandensein des rechten Satzklammerteils, wie die Beispiele (8) und (9) oben zeigen.
Außenfelder
Sie sind intonatorisch und oft auch grafisch (z. B. durch Komma oder Gedankenstrich) vom Satz abgetrennt. Folgende Beispiele illustrieren die Besetzung im linken Außenfeld (26) und im rechten Außenfeld (27):
(27) Sie sagten doch zu, uns zu helfen, Herr Müller!