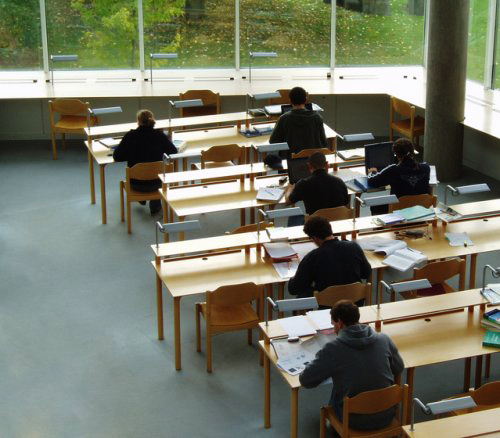Termini/Registertermini
Objekt
Definition
Das Objekt ist ein valenzgebundenes Satzglied, dessen Form (das heißt der Kasus oder die jeweilige Präposition) vom Vollverb vorgegeben wird (Rektion). Objekte werden prototypisch als Nominalgruppe (Akkusativobjekt, Dativobjekt sowie vereinzelt Genitivobjekt) oder Präpositionalgruppe (Präpositionalobjekt) realisiert. Auch ein Nebensatz kann eine Objektfunktion übernehmen.
Beispiele
- Meine Schwester trinkt Milch.
- Er sieht einen Film.
- Sie hilft ihm.
- Er gedenkt der Toten.
- Sie gibt ihm das Buch.
- Sie fürchtet sich davor.
- Der Hund fürchtet sich vor dem Gewitter.
- Wir wissen, dass er schläft.
- Ich weiß nicht, ob er schläft.
- Ich weiß, warum er lügt.
- Wir versprechen, pünktlich zu sein.
- Wir versprechen, die Texte sorgfältig zu lesen.
- Er meint es/das gut mit mir.
Erläuterungen
Das Prädikat legt fest, welche Objekte in einem Satz erforderlich sind (Valenz). Objekte können z. B. betroffene Personen oder Gegenstände ausdrücken, sie übernehmen bestimmte semantische Rollen. Objekte können formal als Pronomen (3, ihm in 5, es/das in 13), Nomen (1), Präpositionaladverbien (6), Wortgruppen (Nominalgruppe: 2, 4, das Buch in 5, die Texte als Objekt zu lesen im infiniten Nebensatz in 12; Präpositionalgruppe: 7), durch einen finiten Nebensatz (meist dass-, ob-, w-Sätze) (8-10) oder einen infiniten Nebensatz (11-12) realisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass Sätze keine Kasus tragen: es wird hier von einem Objektsatz gesprochen. Das Vollverb kann als Formen festlegen (Rektion): einen bestimmten Kasus: Akkusativ (1-2, das Buch in 5; die Texte als Objekt von zu lesen im infiniten Nebensatz in 12, Akkusativobjekt); Dativ (3, ihm in 5, Dativobjekt), Genitiv (4, Genitivobjekt). Manche Verben regieren zwei Objekte (Dativobjekt und Akkusativobjekt in 5). Bei Präpositionalobjekten (6) legt das Vollverb die Präposition fest (fürchten vor, warten auf, sich erinnern an...). In (13) bildet es/das ein rein formales Objekt, das keinen Beitrag zum Satzinhalt leistet.
Grammatische Proben
Objekte sind wie alle Satzglieder gewöhnlich erfragbar, verschiebbar und ersetzbar:
- zu (1): Was trinkt meine Schwester? Milch trinkt meine Schwester. Meine Schwester trinkt das.
Zur Abgrenzung von Präpositionalobjekten und präpositionalen Adverbialen: a) Die Präposition des Präpositionalobjekts kann gewöhnlich nicht durch eine andere Präposition ersetzt werden. b) Präpositionalobjekte können in der Regel durch ein Korrelat ersetzt werden und auch auf ganze Nebensätze verweisen.
- Er freut sich auf die Party. ⭢ Er freut sich darauf, dass die Party heute steigt. / Er freut sich darauf.
Alternative und verwandte Fachausdrücke
–
Hinweise
Werden Objekte erfragt, muss dies vom Vollverb aus geschehen. Man muss beachten, dass eine Frage nach wessen? auch zu Genitivattributen führen kann (Fragebasis ist dann ein Nomen, z. B. Wessen Schal? ⭢ Monikas Schal). Bei besonderen Dativen (man bezeichnet sie auch als ‚freie Dative‘, also nicht valenzgebundene Dative (Valenz), wie den ‚Dativus iudicantis‘: Das ist mir zu stark.) kann die Wem-Frage gestellt werden, ohne dass ein Dativobjekt vorliegt. Da Objekte auch fakultative Ergänzungen sein können, ist die Weglassprobe für die Ermittlung von Objekten nur bedingt geeignet, so kann in (16) das Futter weggelassen werden:
- Der Hund frisst (das Futter)
Bei (13) versagen die Proben. Insbesondere ist es/das nicht in das Vorfeld (Spitzenstellungsprobe) verschiebbar. In seiner rein formalen Funktion ist es als Objekt auf die Position im Mittelfeld beschränkt.
Frequenz:
Am häufigsten sind Akkusativobjekte, dann folgen Präpositionalobjekte und Dativobjekte. Genitivobjekte (wie in 4) treten im Gegenwartsdeutschen nur vereinzelt auf.
In den folgenden Einträgen wird auf Objekt verwiesen:
Visualisierung
Zusatzmaterialien
Zum Text
- Letzte Änderung
- Aktionen Seite als PDF
- Seite teilen
Seite drucken
Seite zitieren