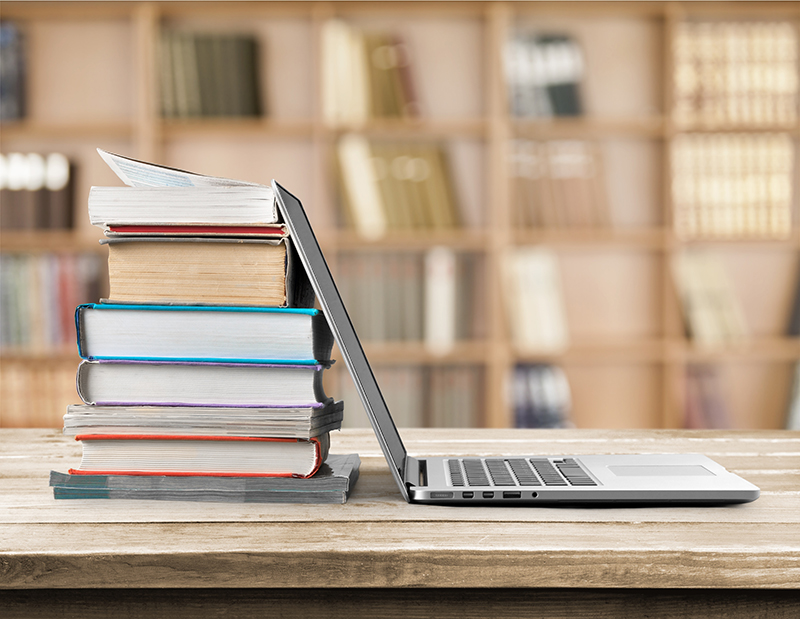Dimensionen einer Charakterisierung durch Prädikate
Klassifikationverfahren
Ob etwas als rot gelten kann oder nicht, hat im Allgemeinen nichts damit zu tun, ob es auch als genehmigungsfähig oder dickflüssig gelten kann. Wechselseitige Unabhängigkeit von Eigenschaften und damit zugleich der entsprechenden Prädikate ist aber nicht immer gegeben. Prädikate sind in aller Regel keine Einzelgänger. Typisch ist vielmehr, dass ganze Spektren von Prädikaten verfügbar sind, deren Verifikationsregeln sich überschneiden, einschließen oder ausschließen können: Was ganz rot ist, kann auch dunkelrot sein, ist in jedem Fall farbig und gewiß nicht grün.
Die offensichtlichen Zusammenhänge zwischen den Wahrheitsbedingungen von Prädikaten erlauben es, regelrechte Dimensionen der Charakterisierung durch Prädikate zu bestimmen und so die fast unüberschaubare Menge verfügbarer Prädikate etwas zu ordnen. Eine Charakterisierung als 'rot' etwa erfolgt im Hinblick auf die Farbe. Sie weist dem so charakterisierten Gegenstand hinsichtlich der Dimension der Farbigkeit den Wert 'rot' zu.
Die Prädikate einer Sprache zu ordnen ist aus vielen Gründen nützlich, vor allem, weil sie fremdsprachigen Lernern den Zugriff auf ganze Beschreibungsrepertoires erleichtert. Doch nicht immer liegt ein Ordnungsprinzip so auf der Hand, dass man es für naturgegeben halten könnte. Die Aspekte der Charakterisierung, die sich auf diese Weise bestimmen lassen, sind theoretische Konstruktionen von mehr oder weniger großer Allgemeinheit, deren Wert allein ihr praktischer Nutzen bestimmt: Sehr allgemeine Dimensionen - wie etwa Konkretheit - und sehr spezielle Dimensionen - wie etwa Schnabelförmigkeit - sind da von eher geringem Interesse.
Die Charakterisierungsdimensionen, die hier angesetzt werden, halten sich auf einer mittleren Ebene. Die Generalisierungen, die dabei vorgenommen werden, sollten für praktische Zwecke brauchbar sein, doch dienen sie in erster Linie der Demonstration des Ordnungsverfahrens.
Auch wenn verschiedenste Einteilungen denkbar sind, so sind doch nicht beliebige Ordnungen möglich. Der Versuch aufzuklären, in welchen Dimensionen Charakterisierungen möglich sind, muss über eine Analyse der Sprache führen und kann nicht etwa bei - vermeintlich - sprachunabhängigen Eigenschaftssystemen oder gar bei den zu charakterisierenden Sachen selbst ansetzen.
Dimensionen der Charakterisierung zu finden, führt über eine Auswertung der logischen Beziehungen, die zwischen den Prädikaten einer Sprache bestehen: Für jedes Prädikat gelten ganz spezifische Bedingungen, unter denen es als wahr oder unwahr zu gelten hat. Die logische Sprachanalyse setzt diese Bedingungen zueinander ins Verhältnis und stellt dann für jedes Paar von Prädikaten fest, wie ihre Wahrheitsbedingungen sind.
I. Die Wahrheitsbedingungen sind identisch, was typischerweise bei Prädikaten der Fall ist, die mit passivfähigen Verben zu bilden sind.
(die tageszeitung 6.4.1998, 14)
Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kultur und Meinung trinken sekündlich 3.300 Tassen Nescafé.
II. Die Wahrheitsbedingungen sind so beschaffen, dass, wenn das eine zutrifft, das andere zutreffen muss, aber nicht umgekehrt.
(Berliner Zeitung 26.8.1998, VI)
Fledermäuse sind Wirbeltiere, die sich von anderen Tieren durch ein einzigartiges Merkmal unterscheiden.
III. Die Wahrheitsbedingungen schließen ein gleichzeitiges Zutreffen aus.
(die tageszeitung 14.9.1989, 13)
Die 10-Francs-Münzen sind größer als die 5-Francs-Münzen.
IV. Die Wahrheitsbedingungen sind voneinander unabhängig.
Pinguine sind Vögel.
Pinguine sind Tiere der Südpolregion.
Das Prinzip der Analyse ist einfach und müsste automatisch zur Entdeckung aller möglichen Dimensionen der Charakterisierung führen, wenn sich die Analyse für alle Prädikate unserer Sprache durchführen ließe: Durch Verrechnung der Ergebnisse der paarweisen Verhältnisse lassen sich Teilmengen von Charakteristiken bestimmen, die dann jeweils als eine Dimension der Charakterisierung gelten könnten. Ein solches Vorgehen muss jedoch scheitern, da die Zahl zu verrechnender Prädikate praktisch unbegrenzt wäre und nicht immer klar ist, unter welchen Bedingungen ein Prädikat als zutreffend gelten soll. Oft sind Sprachteilhaber darüber verschiedener Auffassung, und manchmal kommt man schon selbst nicht zu einem eindeutigen Urteil.
Ordnungsprinzipien
Grundsätzlich sind zwei Ordnungsprinzipien möglich.
- Man kann Prädikate zusammenfassen, denen gemeinsam ist, dass sie ein bestimmtes allgemeineres Prädikat implizieren.
- Man kann Prädikate zusammenfassen, die sich gegenseitig exkludieren oder implizieren.
Wird Prinzip (b) zur Klassenbildung genutzt, ergeben sich - von unterschiedlichen Intuitionen einmal abgesehen - homogene Klassen. Prädikate, die solchen Klassen angehören, werden in aller Regel nicht koordiniert, weil dies entweder zu Kontradiktion oder zu - zumindest stilistisch unglücklichen - Verbindungen von Beschreibungsebenen führen müsste:
Der alte Senator war reich und arm.
Die Bluse war rot und farbig.
Konfrontiert mit solchen Charakterisierungen steigen gutwillige Sprachteilhaber meist auf Interpretationen um, die den augenscheinlichen Widerspruch aufheben: dick und dünn an verschiedenen Stellen, arm und reich in verschiedenem Sinn. Eine Charakterisierung wie "ist rot und farbig" verstößt gegen das allgemeine Kommunikationsprinzip der Informativität, denn ihr zweites Element ist redundant.
Die Charakterisierungsdimensionen, die im Folgenden bestimmt werden, wurden über Prinzip (a) definiert und umfassen auch Prädikate, die Prinzip (b) nicht genügen. Auf den ersten Blick erscheint dies als Mangel, weil die Klassen nicht homogen sind. Homogenität der Klassen nach (b) hat jedoch ihren Preis: Die Klassen schließen nicht alles ein, was unter denselben Oberbegriff fällt. So kann man ängstlich sein und aufgeregt sein zur Charakterisierung der emotionalen Verfassung einer Person gebrauchen, obwohl beide nach (b) nicht einer Klasse zuzurechnen wären.
Prinzip (a) ist flexibler. Es erlaubt umfassendere Klassen. Wird auch auf die Bestimmung homogener Subklassen Wert gelegt, können solche nach Prinzip (b) ausgefiltert werden. Über Prinzip (b) kann die Binnenstruktur der Klassen nach (a) herausgearbeitet werden. Da dies aber zu weiterer substanzieller Ausweitung der Darstellung führen müsste, wird hier auf die Berücksichtigung des Prinzips (b) verzichtet.
Die Bestimmung von Charakterisierungsdimensionen geht - unabhängig vom Grad ihrer Feinheit - von dem Prädikatskonzept aus, das in GRAMMIS als minimales Prädikat bestimmt wird. Solche Prädikate zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur einen Gegenstand - in einem weiten Sinn, der auch Klassen von Individuen und dergleichen umfasst - haben können, dessen Spezifikation an einer Argumentstelle vorzunehmen ist, sondern auch eine größere Zahl von Gegenständen zueinander in Beziehung setzen können. Hier wird diese Eigenschaft minimaler Prädikate zur Subklassifikation genutzt:
- Pauschale Charakterisierung
- Charakterisierungsdimensionen bei Prädikaten mit einer Argumentstelle
- Charakterisierungsdimensionen bei Prädikaten mit zwei Argumentstellen
- Charakterisierungsdimensionen bei Prädikaten mit drei Argumentstellen
- Charakterisierungsdimensionen bei Prädikaten mit vier und mehr Argumentstellen
Der Umstand, dass die Bestimmung der Charakterisierungsdimensionen mit Blick auf die Stelligkeit minimaler Prädikate erfolgt, erlaubt, die Dimensionen auch als semantische Spezifikationen der Argumentstellen zu deuten: Prädikate etwa, die einen Gegenstand hinsichtlich eines Bewirkens charakterisieren, können als Prädikate verstanden werden, die eine Argumentstelle für die Spezifikation eines Täters oder dergleichen haben.
Die Nähe dieser Überlegung zu den semantischen Tiefenkasus der Kasusgrammatik (vgl. etwa Fillmore 1968) ist unverkennbar, auch wenn das theoretische Konzept im Übrigen verschieden ist. Auch die Problematik ist ähnlich: Von einer Argumentstelle für die Spezifikation eines Täters zu reden, setzt ähnliche Abstraktionen voraus wie die Annahme eines AGENS-Kasus. Ein Vorteil des hier vorgestellten Konzepts ist aber darin zu sehen, dass die Bezeichnungen der Charakterisierungsdimensionen weit weniger Gewicht haben als Tiefenkasus. Sie sind nicht mehr als handliche - idealerweise mnemotechnisch geeignete - Etiketten für Klassifikationen, die jederzeit unter Rekurs auf eine logische Analyse der betroffenen Prädikate zu begründen sind. Mit anderen Worten: Die Verteidigungslinie dieses Ansatzes liegt nicht bei den Bezeichnungen, sondern bei der zugrunde gelegten logischen Analyse.